Das vom Bundestag beschlossene Sondervermögen eröffnet der Entwicklung der öffentlichen Infrastruktur viele Möglichkeiten. Am besten, wir nutzen es, um die Lebensqualität für die Menschen in der Region zu erhöhen. Auch mit neuen Lösungen für die Verkehrsinfrastruktur.
VON VOLKER TZSCHUCKE
20 Hallenbäder jährlich
Man kann ja mal eine einfache Rechnung aufmachen. 500 Milliarden Euro Spielraum hat sich der Bundestag mit seiner Entscheidung zur Verfassungsänderung am 18. März dieses Jahres gegeben, um sie in den kommenden zwölf Jahren in die Infrastruktur in Deutschland zu investieren. In Deutschland gibt es 294 Landkreise und 106 kreisfreie Städte, insgesamt also 400 Gebietskörperschaften auf Kreisebene. Nun die Rechnung: Je Gebietskörperschaft stehen damit in den kommenden Jahren 500 Milliarden Euro: 400 = 1,25 Milliarden Euro zur Verfügung. Nach Sachsen mit zehn Landkreisen und drei Kreisfreien Städten müssten demnach etwa 16,25 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen fließen. Oder pro Jahr 1,35 Milliarden Euro. Und zwar zusätzlich zu ohnehin bereits jährlich investierten Geldern. Ob das ausreichend ist angesichts der Mängel staatlicher Infrastrukturen, darf gefragt werden. Das Kompetenzzentrum für kommunale Infrastruktur Sachsen der Universität Leipzig hat Anfang Juni das Ergebnis einer Befragung vorgelegt: „Der von uns berechnete kommunale Investitionsbedarf liegt derzeit allein bis zum Jahr 2028 bei rund 10,9 Milliarden Euro“, erklärte Finanzwissenschaftler Mario Hesse, der Geschäftsführer des Kompetenzzentrums. „Dazu kommen noch einmal 2,1 Milliarden Euro für Instandhaltungsmaßnahmen an der bestehenden Infrastruktur, die sich nicht direkt dem Investitionsbereich zuordnen lassen. Zusammen gehen wir also von einem Infrastrukturbedarf von rund 12 Milliarden Euro aus.“ Das ist zwar weniger als die oben errechneten 16,25 Milliarden Euro, betrifft aber eben auch nur die nächsten drei Jahre bis 2028. Und auch nur die Bedarfe an der kommunalen Infrastruktur. Solche des Landes oder des Bundes sind hier noch nicht mit drin. Südwestsachsen mit Chemnitz und den vier Landkreisen Vogtland, Erzgebirge, Zwickau und Mittelsachsen bekäme nach obiger Rechnung über zwölf Jahre 6,25 Milliarden Euro oder pro Jahr knapp 521 Millionen Euro zusätzlich aus dem Sondervermögen. Auch hier soll die Frage offenbleiben, ob das viel ist. Es ist auf jeden Fall auch nicht ganz wenig. Bezahlen ließen sich davon zum Beispiel 8,7 mal 30 Interventionsflächen für die Kulturhauptstadt (Gesamtkosten: 60 Millionen Euro), 13 neue Brücken über den Südring (geschätzte Kosten: 40 Millionen), die Sanierung von 14 Schauspielhäusern (geschätzte Kosten: 37 Millionen), 16 Oberschulen am Hartmannplatz (Baukosten: 33 Millionen), 20 Hallenbäder wie das neue in Bernsdorf (kosten: 25,5 Millionen) oder 521 Basketballplätze am Konkordiapark (Kosten: 1 Million). Und das pro Jahr, verteilt über ganz Südwestsachsen. Zugegeben, nicht alles davon braucht man überall. Und ja: Die Finanzverteilungsmathematik zwischen Bund, Ländern und Kommunen wird dafür sorgen, dass nicht exakt 6,25 Milliarden Euro zusätzlich in Südwestsachsen landen. Je nach Geschick der lokalen Politik wird es mal mehr, mal weniger Geld sein – und man sollte dringend die Frage stellen: Wie gut sind unsere kommunalen Verwaltungen, auch unsere lokalen Bundes- und Landtagsabgeordneten eigentlich darauf vorbereitet, das Geld anzumahnen, abzurufen, auszugeben?
Die Nutzung folgt dem Angebot
Denn es steht fest: Es kommt auf jeden Fall ein warmer Regen auf uns zu. Ein Bauboom an Straßen, Schienen, öffentlichen Gebäuden. Wenn’s gut läuft, gibt es eine Transformation der öffentlichen Infrastruktur hin zur Zukunftsfähigkeit. Und bitte, es sollte gut laufen! Denn Wandel ist notwendig. Kürzlich war der Autor dieser Zeilen für ein Wochenende per Bahn in Regensburg. Beziehungsweise: in Donaustauf. Das liegt zwar gut zehn Kilometer donauabwärts von Regensburg entfernt, hatte am betreffenden Wochenende aber die deutlich günstigeren Zimmerpreise. Obwohl also räumlich entfernt, war der Autor jeden Tag in Regensburg unterwegs. Zum Shopping und Essengehen nachmittags, im Kino an einem Abend, zu einer Theaterpremiere am anderen. Ein Problem war das trotz Verzichts aufs Auto nicht – es verkehrten Busse zwischen beiden Orten. Regelmäßig! Alle 20 Minuten! Auch bis nach Mitternacht! Und auch am Wochenende! In Chemnitz ist es eine Mutprobe, abends auf einen Bus ins Umland zu hoffen. Schon die zur Stadt gehörenden Randgebiete sind kaum per ÖPNV erreichbar. In Bayern war das kein Problem. Und das Tollste: Alle Busse waren gut ausgelastet. Ob donnerstagnachmittags, samstagnachts oder sonntagvormittags, immer saßen Leute drin. Verkehrsplaner* innen wird das nicht verwundern. Schon lang gilt als belegt, dass Verkehrsströme dem Angebot folgen. Macht man eine Straße breiter, führt das zumeist nicht zu weniger Stau, sondern zu noch mehr Verkehr. Bietet man einen Premiumradweg an, wird der nicht nur rege von Radfahrenden genutzt, sondern (shame on you, das ist eigentlich nicht erlaubt!) auch von Inline-Skater* innen, Spaziergänger* innen und Gassi-Gehenden.
Gibt’s plötzlich eine Ringbuslinie, fahren die Menschen mit dem Ringbus. Fährt hingegen nach dem Theateroder Filmnächtebesuch keine Straßenbahn, führt bei Sonntagsspielen der Niners keine Buslinie an der Messe vorbei, kommen die Gäste: mit dem Auto. Mängel am Chemnitzer Verkehrsnetz ließen sich zuhauf benennen: Radwege, die im Nirgendwo enden, der Nahverkehr monateweise im Ferienbetrieb, Südringbrücken unter Einsturzverdacht. Es ist nicht so, dass man das in der Stadtverwaltung nicht wüsste: Seit 2017/18 wurde hier an einer Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans gearbeitet, der bis ins Jahr 2040 weisen sollte. Als das mit großer Beteiligung erarbeitete Konzept 2023 schließlich dem Stadtrat zur Abstimmung vorgelegt wurde, lehnte dieser es ab: Zu sehr sei es auf besonders umwelt- und klimafreundliche Mobilitätsarten zugeschnitten. Dabei sei Chemnitz doch eine Autostadt und das ganze Konzept ein „Angriff auf die individuelle Mobilität“. Seitdem arbeitet man sich ohne Konzept am Kleinklein ab. Doch wenn man dabei wenigstens konsequent wäre: Wer aufs individuelle E-Auto umsteigt, aber kein Einfamilienhaus hat, muss beim Nachladen seines Fahrzeugs kreativ werden. Die beste Lösung wäre natürlich: Eine eigene Ladesäule am Straßenrand vor dem Haus. Hatte jemand im Nachbarhaus (oder bei der engen Bebauung mancher Stadtteile: einen Block weiter) schon die gleiche Idee: Pech gehabt. Ladesäulen am Straßenrand sind in Chemnitz nämlich nur alle 200 Meter erlaubt. Komisch, wo doch bald jeder ein E-Auto besitzen soll.

Mehr autonome Wagen
Um nicht immer auf der Kulturhauptstadt rumzuhacken: Woanders ist’s auch nicht besser. Anfang Mai legte die „Initiative Transformation Automobilregion Südwestsachsen“ (ITAS) ein Mobilitätskonzept für den Landkreis Zwickau vor. Bei der Untersuchung des Ist-Zustandes sei deutlich geworden, „dass das bestehende Angebot im öffentlichen Personennahverkehr und Schienenpersonenverkehr insbesondere in der Fläche optimiert werden kann.“ Im Landkreis gelte, dass der Nahverkehr „derzeit nicht in allen Fällen den steigenden Anforderungen an eine flächendeckende, wirtschaftlich sinnvolle Anbindung insbesondere von Unternehmensstandorten gerecht wird.“ Schön, wie euphemistisch Wissenschaft schreiben kann! Potenziale sieht man in der Studie bei der Anbindung von Siedlungsbereichen, aber auch bei der Anbindung von Gebieten mit hoher Unternehmenskonzentration. Heißt: Manche Stadtteile und Gewerbegebiete liegen weitab von jedem Bahnhof oder auch nur einer Straßenbahnhaltestelle und sind auch per Bus nicht gut erreichbar. Insbesondere die Taktung ist mangelhaft und beim Anschluss der Gewerbegebiete auch kaum auf Schichtarbeitszeiten angepasst. Das Konzept benennt Achsen in der Region, auf der Verbesserungen erfolgen sollten. Zudem werden Pilotprojekte vorgeschlagen, die einen Wandel vorantreiben könnten. Eine Idee: der stärkere Einsatz von autonomen Fahrzeugen im ÖPNV. „So lassen sich, wenn diese Technologien im Beförderungsalltag angekommen sind, umgehend Maßnahmen ergreifen und angehen“, sagt Andreas Wächtler vom Netzwerk der Automobilzulieferer Sachsen (AMZ), Konsortionalführer im ITAS-Projekt. Auch da könnte die Nachfrage dem Angebot folgen.
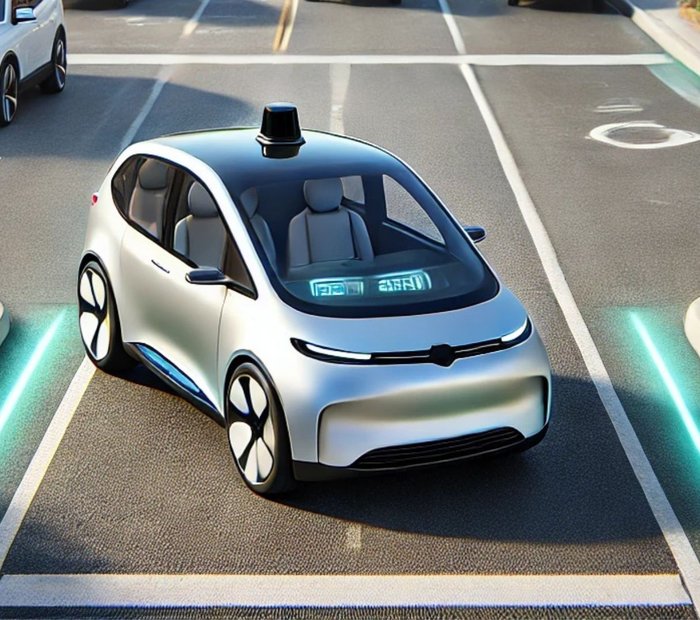
Tun, was andere vormachen
Bei jeglichem Einsatz des Sondervermögens gilt es natürlich zu beachten, dass Verkehrswege im Regelfall für Jahrzehnte gebaut werden. Und da gilt der alte Satz, der mal Karl Valentin, mal Mark Twain zugeschrieben wird: „Prognosen sind schwierig. Vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen.“ Wie sich die mobilen Präferenzen der Bevölkerung entwickeln: Man weiß es nicht. E-Bikes vergrößern plötzlich die Reichweiten von Senior* innen, autonome Busse erlauben viel mehr Nahverkehr, app-gesteuerte Lösungen für Mobilitätsketten ermöglichen den spontanen Wechsel von Verkehrsmitteln. Und wer braucht eigentlich noch Straßen, wenn es Flugtaxis gibt? Es wäre absurd, würde man angesichts der ungewissen Zukunft womöglich die Sondervermögen-Milliarden für Antworten aus einer ziemlich fehlgeleiteten, weil autofixierten Vergangenheit verausgaben. Städte wie Paris, Kopenhagen und selbst Los Angeles machen es vor, wie man das Auto mit einer neuen Prioritätensetzung zurückdrängen kann. Und dabei heißt die neue Priorität nur: Bessere Luft. Mehr Platz. Mehr Sicherheit. Also: Mehr Lebensqualität. Mögliche Schritte dorthin sind bekannt. Zum Beispiel Shared Spaces. Sie behandeln unterschiedlichste Mobilitätsarten gleichberechtigt und machen damit den Verkehr für alle Teilnehmenden sicherer. Um einen Anfang zu machen, ließe sich vor dem Chemnitzer Marx-Monument eine solche Zone beim geplanten Neubau der Straßenbahnlinie nach Leipzig problemlos mitdenken. Sie würde die kaum zu überwindende Brückenstraße zu einem gemeinschaftlich genutzten Raum machen und so die lang ersehnte Verbindung von Stadtzentrum und Brühl ein stückweit näher rücken lassen. Oder: Mobilitätsräume unterschiedlicher Verkehrsträger müssen nicht zwingend parallel zueinander verlaufen. Fahrradwege könnten sich also beispielsweise weniger am Verlauf von Hauptverkehrsstraßen orientieren, sondern stärker an topografischen Gegebenheiten, um leichter nutzbar zu werden. Oder: Beim Bau von Häusern muss vielleicht nicht immer auch für jede Wohneinheit ein Parkplatz geschaffen werden. Es ist an uns, darauf zu achten, dass das Sondervermögen nicht einfach nur „irgendwie“ ausgegeben wird. Sondern so, dass es unser Leben verbessert. Auch in Chemnitz und Südwestsachsen. Vielleicht beauftragen wir ja künftig nicht immer nur das billigste Angebot. Sondern zuweilen auch das zukunftsfähigste.